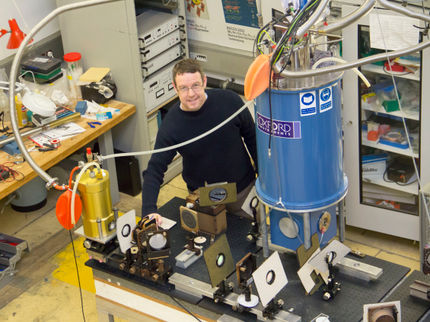Magnetismus ohne Metall: Ein Meilenstein für die Materialwissenschaft
„Das ist fundamental neu“
Dr. Hongde Yu und Prof. Thomas Heine von der TU Dresden ist es erstmals gelungen, metallfreie magnetische Materialien durch präzise Computersimulationen vorherzusagen. Diese magnetischen zweidimensionalen (2D) Polymere könnten in Zukunft eine wichtige Rolle in der Datenspeicherung, Medizintechnik oder Quantencomputing spielen. Ihre Entdeckung wurde kürzlich in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlicht.

© Thomas Heine
Magnetismus fasziniert die Menschen seit Jahrhunderten: Ob Kinder, die mit Magneten spielen, oder Wissenschaftler:innen, die die fundamentalen Kräfte hinter dem Phänomen erforschen. Es ist weitläufig bekannt, dass Magnetismus in der Natur meist eng mit Metallen verbunden ist – die klassischen Permanentmagnete zum Beispiel basieren auf Eisen oder anderen Metallen.
Nun haben Hongde Yu und Thomas Heine von der Professur für Theoretische Chemie an der TU Dresden erstmals durch Berechnungen gezeigt, dass es möglich ist, Magnetismus auch in rein organischen Materialien zu erzeugen. Als grundlegenden Baustein verwendeten die Wissenschaftler sogenannte Triangulene, dreieckige Moleküle, die ungepaarte Elektronen und somit ein magnetisches Moment besitzen. Wenn man diese Molekülbausteine zu einem 2D-Festkörper verbindet, ordnen sich diese ungepaarten Elektronenspins und erzeugen so ein ferromagnetisches Material.
„Das ist fundamental neu“, erläutert Hongde Yu. „Üblicherweise haben die Elektronenspins in organischen Materialien eine zufällige Orientierung und heben sich somit im Festkörper auf. Durch geeignete chemische Bindungen ordnen sich die Spins im 2D-Kristall an, wodurch ein ferromagnetisches Material entsteht.“
„Der Magnetismus beruht auf der robusten Kopplung der Elektronenspins zwischen benachbarten molekularen Bausteinen. Im Gegensatz zum Magnetismus in Metallen, wo die Elektronenspins an den Metallatomen lokalisiert sind, sehen wir eine delokalisierte Spindichte, die sich über den gesamten Triangulen-Molekülverbund verteilt. Dabei können sich, je nach Molekülzusammensetzung, sogenannte "Stoner-Ferromagnete", bei denen die Spins benachbarter Moleküle parallel sind, oder antiferromagnetische Mott-Isolatoren, wo die Spins benachbarter Moleküle entgegengesetzt sind, bilden“, erklärt Heine. Die Entdeckung, dass man magnetische Momente in metallfreien Materialien geordnet koppeln kann, öffnet die Tür für die Entwicklung von magnetischen Materialien, bei denen Metalle unerwünscht sind, z.B. aufgrund ihres Gewichts oder ihrer Toxizität. Metallfreie Magnete könnten sich als robuster und biokompatibler erweisen, was insbesondere in der Medizintechnik von Bedeutung wäre.
Mit dieser bahnbrechenden Arbeit hat das Forschungsteam eine neue Klasse von magnetischen Materialien entdeckt, die nicht nur theoretisch faszinierend ist, sondern auch das Potenzial hat, zukünftige technologische Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen.
Originalveröffentlichung
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.