Forscher entwickeln optischen Miniatur-Abakus
Ein Miniatur-"Rechenbrett", auf dem mit Lichtsignalen gerechnet werden kann, haben Wissenschaftler der Universitäten Münster, Exeter und Oxford entwickelt. Mit dem Bauteil haben sie einen Weg zur Entwicklung neuartiger Computer eingeschlagen, bei denen wie im menschlichen Gehirn die Recheneinheit und der Speicher in einem Element zusammengefasst sind – im Gegensatz zu herkömmlichen Rechnern, bei denen beides nach dem sogenannten Von-Neumann-Prinzip getrennt ist.
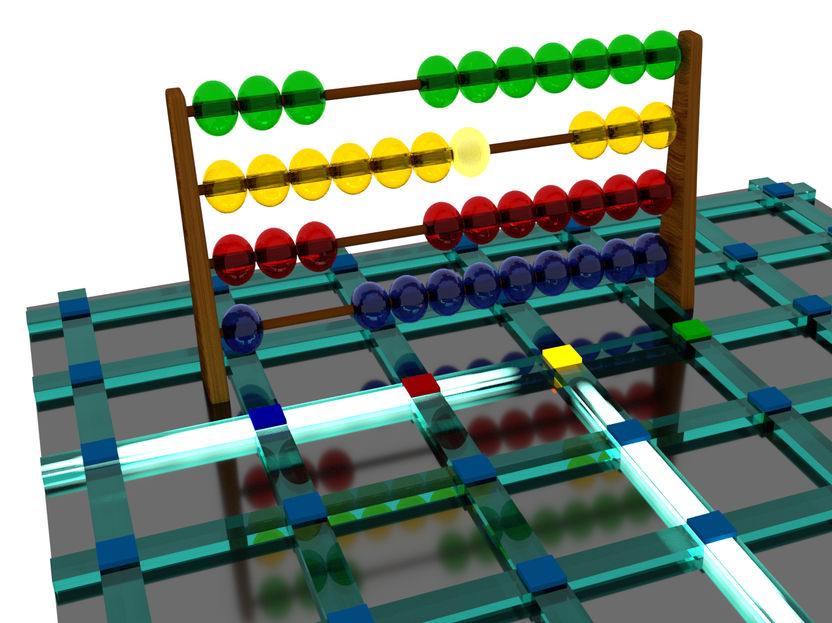
Schematische Darstellung eines Chips mit Wellenleitern. Die Speicherelemente liegen jeweils auf den Kreuzungen. Der Abakus ist zur Veranschaulichung eingezeichnet.
Illustration: WWU/Johannes Feldmann
"In dem Artikel beschreiben wir erstmals die Realisierung eines Abakus, der rein optisch funktioniert. Statt Holzperlen auf einer Stange zählt unser Abakus Lichtpulse und speichert sie in einem Phasenwechsel-Material, wie es auch für wiederbeschreibbare DVDs verwendet wird", erklärt Studienleiter Prof. Dr. Wolfram Pernice vom Physikalischen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU). Der optische Abakus ist auf einem Mikrochip implementiert und lässt sich einfach vervielfältigen. Die Forscher können ihn über integrierte Optiken beschreiben und auslesen und mit ihm alle Grundrechenarten durchführen. Bisher gelang es den Forschern, mit zweistelligen Zahlen zu rechnen. Da für jede Ziffernposition ein eigenes Rechenelement eingesetzt wird und der optische Abakus aus neun Rechenelementen besteht, kann er aber auch mit sehr viel größeren Zahlen arbeiten.
Die Forscher verfolgen das langfristige Ziel, sogenannte neuromorphe Rechnerarchitekturen zu erschaffen – also Computer, die einem Gehirn nachempfunden sind. Ein wesentliches Merkmal ist die Aufhebung der Trennung zwischen Recheneinheit (Prozessor) und Datenspeicher. "Wir rechnen außerdem mit Licht statt mit Elektronen wie bei herkömmlichen Computern. Denn dadurch können wir viel schnellere Systeme entwickeln, die mit Wellenleitern vernetzt werden", sagt Mitautor Prof. Harish Bhaskaran von der Universität Oxford.
Die Wissenschaftler benötigen dafür verschiedene Komponenten, unter anderem künstliche Nervenzellen und künstliche Synapsen, also "Schaltstellen" zwischen den Nervenzellen. Die künstlichen Synapsen realisierten die Forscher bereits vor Kurzem im Rahmen einer anderen Studie. "Wenn es uns gelingt, ein vollständiges Rechnersystem zu entwickeln, könnten wir große Datenmengen direkt verarbeiten – ohne den Umweg über elektronische Systeme", unterstreicht Prof. David Wright von der Universität Exeter.
Aus Sicht der Wissenschaftler sind die Ergebnisse Erfolg versprechend. Bei der Arbeit handelt es sich jedoch um Grundlagenforschung. Ob und wann sie zur Anwendung kommt, ist noch nicht absehbar. Die Studie wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Originalveröffentlichung
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.



























































