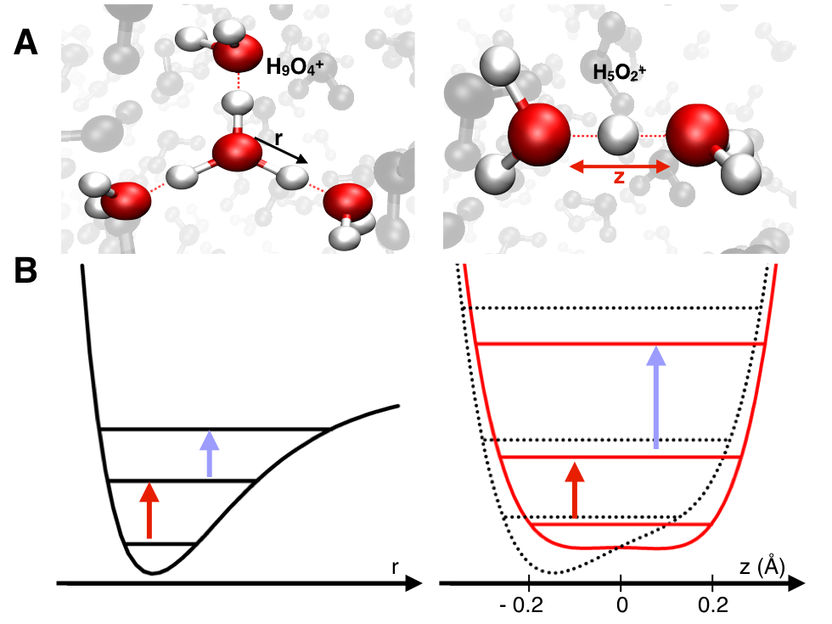Von der Siliziumtechnik zur molekularen Elektronik: Wissenschaftler wollen die Brücke zur Mikroelektronik der Zukunft schlagen
Kann Elektronik noch kleiner und leistungsfähiger werden? Forscher am Institut für Halbleitertechnik an der Technischen Universität Braunschweig entwickeln gemeinsam mit Kollegen an der Universität Princeton (New Jersey, USA) und an der TU München neuartige Bauelemente für zukünftige Computerchip-Generationen.

Im Chemielabor des Instituts für Halbleitertechnik werden Silizium-Chips mit Nanometer-dicken Lagen organischer Moleküle beschichtet.
K. Burghardt / TU Braunschweig / IHT
Die kleinsten elektronischen Bauelemente haben heute Komponenten mit Abmessungen im Bereich weniger Nanometer erreicht. Sie finden sich z. B. als Transistoren bereits milliardenfach in Computern. Die Silizium-Technologie stößt damit - was die Miniaturisierung angeht - langsam an ihre Grenzen. Weltweit suchen Forscher daher intensiv nach neuartigen Materialien und Bauelementen, welche in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die heutige Siliziumtechnik ergänzen oder irgendwann sogar ersetzen könnten. Als sehr aussichtsreich gelten organische Moleküle, also künstlich hergestellte, chemische Nanoteilchen, welche die Aufgaben konventioneller Bauelemente wie Dioden, Schalter oder Transistoren übernehmen und durch neuartige Funktionen erweitern würden. Rein organische elektronische Schaltkreise werden aber in den nächsten Jahren noch Utopie bleiben.
Forscher aus Braunschweig um Prof. Marc Tornow wollen nun eine Brücke von der heutigen Siliziumtechnik zur zukünftigen molekularen Elektronik schlagen. "Unser Ziel ist es, Siliziumkontakte im Nanometerbereich herzustellen, mit denen die Moleküle elektrisch angeschlossen werden können", erläutert Tornow. Ihre Partner aus der organischen Chemie der Universität Princeton (Prof. Jeffrey Schwartz, Prof. Steven Bernasek) bringen die speziell hergestellten, leitfähigen Moleküle in das Projekt ein, welche sich als hochgeordnete Schichten auf Silizium abscheiden lassen. Diese Funktionalisierung der Oberfläche erfolgt in enger Kooperation mit Wissenschaftlern des Walter-Schottky-Instituts der TU München (Prof. Gerhard Abstreiter, Dr. Anna Cattani-Scholz), die ebenfalls Partner im Projekt sind.
Die Arbeiten werden an der TU Braunschweig mit rund 220.000 Euro durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert. Im Rahmen des dreijährigen, bilateralen Projekts erhalten die US-amerikanischen Partner eine parallele Förderung durch die National Science Foundation.
Meistgelesene News
Organisationen
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.
Meistgelesene News
Weitere News von unseren anderen Portalen
Zuletzt betrachtete Inhalte
Neuer Bayer CropScience-Wirkstoff erhält Registrierung in Rumänien: Thiencarbazone-Methyl weltweit erstmals zugelassen - Umsatzpotenzial von mehr als 100 Millionen Euro für neuen Mais-Herbizidwirkstoff
Chemie-Rückstände im Wasser: Fahrplan gegen Spurenstoffe vereinbart