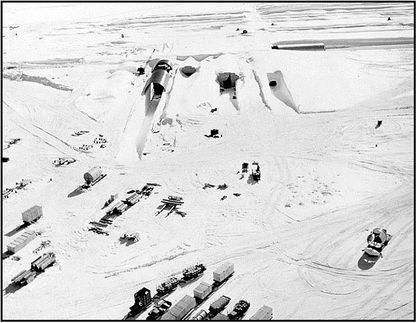Vom langsamen Abbau bestimmt
Warum reichern sich Umweltgifte in den kalten Polarregionen an? Für viele Substanzen hat dies nicht so sehr damit zu tun, dass sie bei Kälte weniger flüchtig sind, wie lange vermutet, sondern vor allem mit ihrem extrem langsamen natürlichen Abbau.
Zwar wurden und werden langlebige Umweltgifte weltweit ausgestossen, in der Arktis und Antarktis ist die Umwelt jedoch deutlich stärker belastet als andernorts. Die dortigen Meerestiere gehören zu den am stärksten mit langlebigen organischen Schadstoffen (POP, für englisch: persistent organic polluants) kontaminierten Lebewesen. Und bei den in der Arktis lebenden Inuit, auf deren Speiseplan Fische, Robben und Wale eine wichtige Rolle spielen, werden sehr viel höhere POP-Konzentrationen nachgewiesen als bei Menschen in unseren Breitengraden.
Mittlerweile werden Herstellung und Verwendung von knapp zwei Dutzend POP und einer Reihe von ozonschädigenden Substanzen in zwei internationalen Übereinkommen, der Stockholmer Konvention und dem Montreal-Protokoll, stark eingeschränkt. Warum die vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts emittierten Umweltgifte, nachdem sie von Luft- und Meeresströmungen weltweit verteilt wurden, in den Polarregionen Depots gebildet haben, ist nicht restlos geklärt. Daher ist es auch schwierig, genaue Voraussagen zu ihrem langfristigen Verbleib zu machen. Forschende der ETH Zürich sind nun den physikalischen und chemischen Prozessen, welche die Dynamik der Schadstoffe regulieren, auf den Grund gegangen.
Reale und hypothetische Substanzen simuliert
Für die Anreicherung standen bisher vor allem zwei Faktoren zur Diskussion, die beide mit der in den Polarregionen herrschenden Kälte zu tun haben: Bei tiefen Temperaturen sind chemische Verbindungen weniger flüchtig, Dampf kondensiert. Experten haben lange vermutet, dass in diesen physikalischen (thermodynamischen) Eigenschaften der Hauptgrund für die Anreicherung liegt. Die Anreicherung in den Polarregionen entspricht nach dieser Auffassung der von der Physik bestimmten und natürlich erreichten langfristigen globalen Verteilung. Der zweite Faktor: Auch der chemische und mikrobiologische Abbau von Stoffen ist temperaturabhängig. Die ohnehin prinzipiell schlecht abbaubaren Umweltgifte werden in der Kälte noch langsamer abgebaut als in wärmeren Weltgegenden. Dieser Faktor wurde bisher allerdings als weniger bedeutend eingeschätzt.
Forschende um Martin Scheringer, Gruppenleiter an der Professur für Sicherheits- und Umweltschutztechnologie in der Chemie, haben nun die beiden Effekte verglichen. In einem von ihnen entwickelten Computermodell simulierten sie den Verbleib von einem guten Dutzend real existierenden und einigen hundert hypothetischen Umweltgiften. Das Modell berücksichtigte neben geografischen Komponenten wie Meeres- und Luftströmungen die Präferenz der Substanzen für Wasser, Boden und Luft sowie ihre Abbaugeschwindigkeit in diesen Umgebungen.
Nur flüchtige Stoffe erreichen den Zielzustand
In ihrer Studie konnten die Wissenschaftler zeigen: Nur für stark flüchtige Stoffe, die sich in der Atmosphäre anreichern, wie beispielsweise die früher als Kühlmittel eingesetzten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) oder das früher in Feuerlöschern verwendete Tetrachlormethan ist die bisherige Vermutung richtig, wonach die thermodynamischen Eigenschaften massgebend sind. «Stark flüchtige Substanzen sind so mobil, dass sie die von den thermodynamischen Eigenschaften bestimmte geografische Verteilung verhältnismässig schnell erreichen können», sagt Scheringer.
Für Substanzen, die sich vor allem im Wasser, im Boden und im Fettgewebe von Lebewesen anreichern, wie etwa das berüchtigte Insektizid DDT oder die als elektrische Isolatoren oder Fugendichtungen eingesetzten Polychlorierten Biphenyle (PCB), gilt dies nicht. «Ihr Verteilungsmuster in der Umwelt wird durch den langsamen Abbau in der Kälte und den schnelleren Abbau in warmen Regionen bestimmt», erklärt Scheringer. Den thermodynamischen Zielzustand erreichten sie nicht.
Modellrechnung mit Vorteilen
«Unsere Modellrechnung hat Vorteile gegenüber der Analyse von Messdaten», so Scheringer. Zwar seien auch bei Messungen Muster und gewisse Mechanismen erkennbar, doch Messungen würden von Messunsicherheiten und einem erheblichen Hintergrundrauschen beeinträchtigt. Eine Modellrechnung dagegen sei idealisiert, in ihr könne das Hintergrundrauschen ignoriert werden. Ein weiterer Vorteil: Mit einem Modell sind Hochrechnungen für die Zukunft möglich.
Auch wenn nun die physikalischen Hintergründe für die Anreicherung bekannt seien, ändere sich dadurch für die betroffenen Bewohner der Arktis unmittelbar wenig, ist sich Scheringer bewusst. «Wir können diese Stoffe nicht mehr aus der Umwelt zurückholen. Der einzige Weg ist, sie nicht mehr zu emittieren», sagt er. Und dies sei das erklärte Ziel der Stockholmer Konvention.