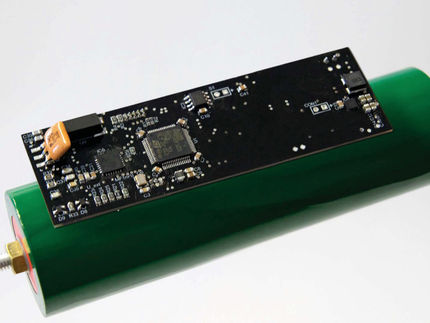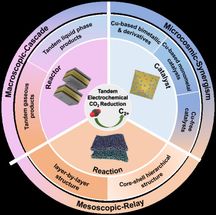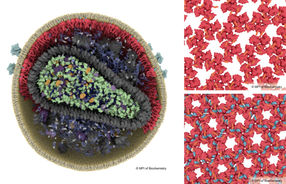Leitfähige Nanoröhren aus einem Guss
Im Elektroauto ohne Aufladen einmal quer durch Deutschland? Die Industrie setzt dafür auf die Entwicklung leistungsfähiger Lithium-Schwefel-Akkus. LMU-Chemiker stellen jetzt ein Material vor, das Schwefel besonders gut bindet und so die Speicherkapazität der Batterien verbessern könnte.
Ob wir in Zukunft alle mit Elektroautos über die Straßen schnurren, hängt vor allem von der Entwicklung neuer Batterien ab. Große Hoffnung setzt die Industrie auf Lithium-Schwefel-Akkus, die eine sehr hohe Speicherkapazität besitzen. Zudem sind sie durch die Schwefelkomponente günstiger und ungiftiger als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Doch Schwefel hat einen Nachteil. Es nimmt Elektronen vom Lithium gut auf, aber transportiert sie schlecht weiter. Wissenschaftler versuchen daher, das Element an besonders leitfähige Kohlenstoff-Nanofasern zu binden.
Viele Poren für den Schwefel
Thomas Bein, Professor für Physikalische Chemie an der LMU und Koordinator des Bereichs Energiekonversion bei der Nanosystems Initiative Munich (NIM), und seine Mitarbeiter haben jetzt neuartige Nanofasern hergestellt, die durch viele hochgeordnete Poren eine außergewöhnlich große Gesamtoberfläche besitzen. Bei einem Stück dieses Materials von der Größe eines Zuckerwürfels wäre das die Fläche von mehr als sieben Tennisplätzen.
„Eine große Oberfläche ist wichtig, damit der Schwefel an der Elektrode feinverteilt gebunden werden kann und effizienter für weitere elektrochemische Prozesse während der Lade- und Entladezyklen zur Verfügung steht. Hierbei sind entscheidende Reaktionen des Schwefels mit einem zusätzlichen Elektrolyten, an denen Elektronen und Ionen beteiligt sind, enorm von der gegebenen Oberfläche abhängig“, erklärt Benjamin Mandlmeier, Erstautor und Post-Doktorand am Lehrstuhl von Thomas Bein.
Das Geheimrezept der Nanofasern
Neue Ausgangsstoffe und ein raffiniertes Herstellungsverfahren sind das Geheimrezept des neuen Materials. Ähnlich wie im Metallguss nehmen die Chemiker einen Abdruck von einer Vorlage aus kommerziell erhältlichen, aber nicht porösen Fasern. Die so gewonnenen Formen füllen sie anschließend mit einer speziellen Mischung aus Kohlenstoff, Siliziumdioxid und einem Tensid. Das Ganze wird bei 900 °C gebrannt und die Gussform und das Siliziumdioxid am Ende weggeätzt. Durch dieses Verfahren schrumpfen die Röhren und damit die Poren nicht so stark wie beim Brennen ohne Gussform und die ganze Faser bleibt stabiler.
„In nanostrukturierten Materialien steckt noch ein großes Potenzial, um Energie effizienter umzuwandeln und zu speichern“, erklärt Thomas Bein. „Wir arbeiten unter anderem mit Kollegen im Bayerischen SolTech-Netzwerk auch in Zukunft intensiv daran, die Möglichkeiten solcher Strukturen zu entschlüsseln und nutzbar zu machen.“
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft
Meistgelesene News
Weitere News von unseren anderen Portalen
Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten
Themenwelt Batterietechnik
Die Themenwelt Batterietechnik bündelt relevantes Wissen in einzigartiger Weise. Hier finden Sie alles über Anbieter und deren Produkte, Webinare, Whitepaper, Kataloge und Broschüren.

Themenwelt Batterietechnik
Die Themenwelt Batterietechnik bündelt relevantes Wissen in einzigartiger Weise. Hier finden Sie alles über Anbieter und deren Produkte, Webinare, Whitepaper, Kataloge und Broschüren.