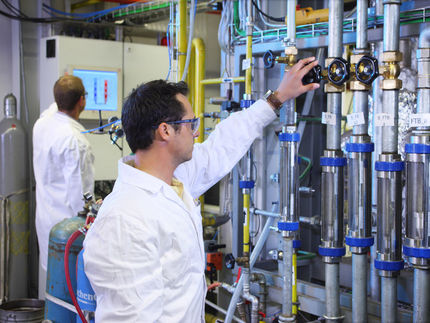Der Natur nachempfunden
Wissenschaftler entwarfen sich selbstorganisierende kugelförmige Netzwerke aus organischen Molekülen
Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Entstehung des Lebens bestand in der spontanen Selbstorganisation identischer kleinerer Einheiten zu größeren symmetrischen Strukturen. So sind zum Beispiel die Hüllen vieler Viren aus zahlreichen gleichartigen Untereinheiten zusammengesetzt. Auf diese Weise wird mit einem Minimum an Information, einem einzelnen Gen, das die Bauanleitung für ein bestimmtes Protein ist, ein Maximum an struktureller Komplexität erzeugt, eben jene kugelförmige Virushülle, die aus 60 oder mehr einzelnen, aber immer wieder gleichen Eiweiss-Bausteinen besteht.
An diesem Konstruktionsprinzip der Natur orientierten sich M. Fujita und seine Kollegen, als sie ihre selbstorganisierenden kugelförmigen Netzwerke aus organischen Molekülen entwarfen. Aus bereits bekannten Forschungsarbeiten wussten sie, dass kurze stäbchenförmige Moleküle, deren beide Enden mit Metallen in Wechselwirkung treten können, zweidimensionale Gitter bilden. Diese Netzwerke besitzen keine festgelegten Grenzen und können im Prinzip endlos wachsen. Die Wissenschaftler verwendeten für ihre Experimente deshalb leicht gebogene Moleküle und behandelten sie mit einer Lösung, in der das Edelmetall Palladium enthalten war. Dabei entstanden spontan große kugelförmige Gebilde mit einem Durchmesser von etwa 4 nm. In verschiedenen analytischen Meßverfahren verhielt sich jedes Kügelchen wie ein einzelnes großes Molekül, die Kugeln ließen sich sogar kristallisieren. So gelang es auch, ihre Zusammensetzung exakt zu bestimmen, sie bestehen aus jeweils 12 Metall- und 24 organischen Zentren.
Einfallsreiche Chemiker können nun die Oberfläche der Kügelchen auf vielfältige Weise verändern, denn funktionelle Gruppen, die mit den organischen Liganden verknüpft werden, erscheinen gleichmäßig über die Oberfläche der Kugel verteilt. So koppelten die japanischen Forscher beispielsweise Porphyrinsysteme an die Liganden. Diese bestehen aus vier miteinander verbundenen stickstoffhaltigen fünfgliedrigen Ringen, die um ein Metallzentrum angeordnet sind. In der Natur kommen Porphyrine z.B. in lichtabsorbierenden Proteinen oder im grünen Blattfarbstoff, dem Chlorophyll, vor. Sie dienen dazu, die Energie des Sonnenlichtes aufzunehmen und für biochemische Synthesen in der Pflanzenzelle bereitzustellen. Im Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff der Wirbeltiere, besorgt ein Porphyrinsystem den Transport und Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid. Vielleicht lassen sich mit der Methode von Fujita und seinen Kollegen einmal winzige Gas- oder Lichtsensoren herstellen.
Meistgelesene News
Themen
Organisationen
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.